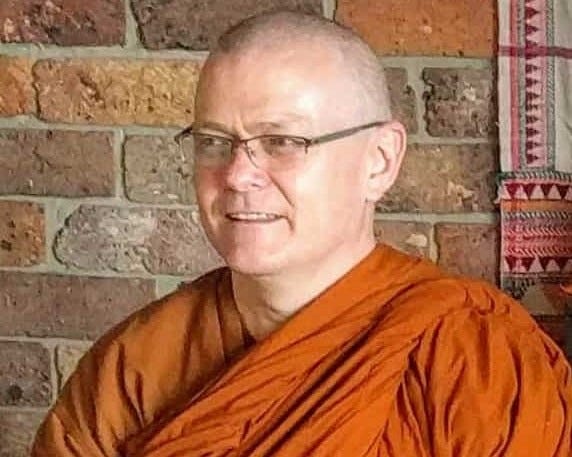Das erste Jātaka?
Übersetzung von „The first Jataka?“ von Bhikkhu Sujato, 2012
Ich habe die Gelegenheit genutzt und Bhikkhu Bodhis (wie immer!) wunderbare Übersetzung des Aṅguttara-Nikāya gelesen. Wenn Sie das Buch noch nicht haben, worauf warten Sie noch?
Mir ist ein kleines Sutta in den Dreiern aufgefallen, und es kam mir der Gedanke, dass dieser unscheinbare kleine Text wahrscheinlich der beste Anwärter auf den Titel der ersten Jātakageschichte im Buddhismus ist. Der Text ist AN 3.15 Pacetana. Es gibt keine bekannten Parallelen für diesen Text, was allerdings für den Aṅguttara-Nikāya nicht ungewöhnlich ist.
Was sind die Jātakas?
Jātakas erzählen Ereignisse aus den früheren Leben des Buddha und manchmal auch anderer Personen, die mit ihm zusammen gelebt haben. Sie sind im traditionellen Buddhismus allgegenwärtig: Sie werden in Predigten erzählt, Kindern beim Schlafengehen vorgelesen, bei großen Zeremonien rezitiert und in Kunstwerken dargestellt. Doch eins der für buddhistische Texte auffälligsten Dinge ist, wie wenige davon in den frühen Lehren sind. Allein die Palitradition bewahrt zwar über 500 Geschichten als kanonische Texte und viele weitere in späteren Sammlungen, aber in den frühen Nikāyas / Āgamas finden sich nur ca. ein Dutzend. Es gibt einen ausgezeichneten Essay zum Thema von T.W. Rhys Davids. Er ist ein wenig veraltet, aber immer noch sehr lesenswert. Doch Rhys Davids macht keine Bemerkung zu unserem hier vorliegenden Sutta.
Ich bin tatsächlich äußerst verblüfft, wie wenige Geschichten es im Aṅguttara (und in anderen Nikāyas) gibt. Der Buddhismus ist eine der größten Geschichten erzählenden Traditionen der Welt, und doch scheint der Buddha selbst überhaupt nicht viele Geschichten erzählt zu haben. Die überwiegende Mehrzahl der Suttas sind einfache Aussagen oder Dialoge über Ethik, Meditation und Ähnliches. Sie sind oft mit Gleichnissen illustriert, etwas weniger häufig mit kurzen Parabeln. Aber es gibt sehr wenig in der Art von ausgedehntem Narrativ; und das meiste Narrativmaterial, das vorkommt, ist in Hintergrunderzählungen, nicht in dem, was vom Buddha selbst gesprochen ist. Natürlich gibt es Ausnahmen wie das Aggañña- oder das Cakkavattisutta des Dīgha; aber diese sind vereinzelt.
Das Pacetanasutta ist eine andere solche Ausnahme. Es ist eine einfache Geschichte, an deren Ende der Buddha sich mit der Hauptperson identifiziert und sie damit als Jātaka ausweist. Es gibt zwar verschiedene andere Jātakas in den frühen Āgamas, doch die meisten von ihnen enthalten Merkmale, die stark dafür sprechen, dass sie jüngeren Datums sind als die meisten der frühen Suttas. Als Einziges unter den Āgama-Jātakas enthält, soweit ich das sagen kann, das Pacetanasutta eine Reihe von Merkmalen, die nahelegen, dass es ein früher Text ist.
Die Geschichte
Hier ist eine Zusammenfassung aus dem Wörterbuch der Pali-Eigennamen (Dictionary of Pali Proper Names; Deutsch von S. Sabbamitta):
Es war einmal ein König mit Namen Pacetana, der bat seinen Wagenbauer, ihm für eine Schlacht, die sechs Monate später stattfinden sollte, ein Paar Räder zu machen. Als von dieser Zeit noch sechs Tage übrig waren, war nur ein Rad hergestellt, aber das andere wurde innerhalb der festgesetzten Zeit fertiggestellt. Pacetana dachte, beide Räder wären gleich, aber der Wagenbauer zeigte ihm, dass das Rad, das er eilig gemacht hatte, in verschiedener Weise fehlerhaft war, da seine Teile krumm waren. Der Buddha identifizierte sich mit dem Wagenbauer und erklärte, man solle frei von allen Krummheiten sein, damit man nicht von der Lehre und Schulung abfällt.
Die vollständige Übersetzung können Sie hier finden.
Warum ist dieses Sutta besonders?
Dies ist einer jener Fälle, in denen es nicht das eine Ding gibt, das besonders ungewöhnlich ist. Es sind vielmehr viele kleine Details, die zusammengenommen für mich darauf hinweisen, dass der Text sich irgendwie heraushebt und vielleicht ursprünglich die erste Jātakageschichte war oder als solche angesehen wurde. Hier sind einige Punkte aufgezählt, die mir aufgefallen sind:
Der König ist unbekannt. Er ist kein stereotyper König wie der Brahmadatta, den man in so vielen späteren Jātakas findet.
Der Buddha identifiziert sich nicht als Bodhisatta in der Vergangenheit. Das ist ein typisches Merkmal aller frühen Jātakas. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Buddha in der Vergangenheit wusste, dass er zum Erwachen bestimmt war oder dass er sich auf einer viele Leben umspannenden spirituellen Suche befand oder auch nur, dass das, was er in jenem Leben tat, irgendetwas mit dem Erwachen zu tun hatte. In anderen frühen Jātakas verneint er sogar ausdrücklich, dass die Übungen jener Tage zum Erwachen führen. (Vor diesem Hintergrund werde ich mich in dieser Diskussion nicht auf ihn als den Bodhisatta beziehen.)
Während der Buddha sich in den meisten kanonischen Jātakas mit einem großen König oder Weisen der Vergangenheit identifiziert, identifiziert er sich hier mit einem einfachen Wagenbauer. In vielen anderen Suttas des Aṅguttara wird der Beruf des Wagenbauers als einfache, niedere Beschäftigung wie die des Straßenkehrers, Blumensammlers oder Abfallbeseitigers aufgezählt. (Die Übersetzung des Ehrwürdigen Bodhi verschleiert diesen Punkt etwas; die Übersetzung verwendet das etwas vornehmere „Wagenbauer“ (chariot-maker) hier und „Karrenbauer“ (cart-maker) an anderen Stellen; aber im Pali heißt es jedesmal rathakāra.)
Es gibt eine ausgesprochene Abwesenheit von Wundern oder wunderbaren Ereignissen. Selbst als er vom König unter Druck gesetzt wird, ist der Wagenbauer nicht in der Lage, seinen Job gut auszuführen. Er ist offensichtlich von den üblichen Anforderungen seines Handwerks eingeschränkt, im Gegensatz zu den beinahe übermenschlichen Fähigkeiten von Bodhisattas in vielen anderen Geschichten.
Der Wagenbauer scheint mit einem falschen Lebenserwerb beschäftigt zu sein, oder zumindest mit einem ethisch fragwürdigen Handwerk: der Herstellung von Kriegswaffen. Es ist wahr, es gibt viele Jātakas späterer Zeit, in denen der Bodhisatta als jemand dargestellt ist, der verschiedene Ethikregeln bricht, aber es ist dennoch bemerkenswert. Es ist vielleicht auch bedeutsam, dass der Wagen, besonders der zweirädrige Streitwagen, das charakteristische Kriegsfahrzeug der indo-arischen Völker und, so scheint es, die entscheidende technologische Innovation war, die ihren großen Erfolg beim Verbreiten ihrer Kultur in der Welt antrieb; so wenig aufzuhalten wie das Rad des Dhamma selbst …
Die Moral der Geschichte ist die Wichtigkeit der stufenweisen Entwicklung. Während dies in den Suttas überhaupt nicht ungewöhnlich ist, unterscheidet es sich von späteren Trends, die eine augenblickliche Realisation betonen.
Es gibt erhebliche Verwirrung über den Namen, sowohl den des Königs als auch den des Sutta. Varianten umfassen Pacetana, Sacetana, Paccetana usw.; und das Sutta wird manchmal „Cakkavatti“ genannt. Das ist interessant, da sich das Sutta auf das „Vorwärtsrollen eines Rades“ bezieht, aber nicht auf den „Rad-drehenden Herrscher“, was Cakkavatti normalerweise bedeutet. Das vorausgehende Sutta erwähnt in der Tat den Rad-drehenden Herrscher; da scheint es eine Vermischung zu geben. Vielleicht – und das ist reine Spekulation – war das Pacetanasutta der Kern, von dem sich die Vorstellung des Rad-drehenden Herrschers abgeleitet hat.
Zum gleichen Thema und auf einer solideren Grundlage fällt auf, dass es heißt, dieses Sutta, das davon handelt, „ein Rad vorwärts zu rollen“, spiele in Benares im Wildpark. Das ist natürlich der Ort, an dem der Buddha seine erste Lehrrede hielt, das Dhammacakkappavattana-Sutta, „Das Rad des Dhamma vorwärts rollen“; und hier werden die gleichen Worte gebraucht. Obwohl an diesem Ort nach der ersten Lehrrede einige weitere Suttas gelehrt wurden, war es keine sehr häufige Kulisse. Dieses Detail fällt noch mehr auf, wenn wir uns klarmachen, dass sehr wenige Suttas im Aṅguttara einen konkreten Ort haben, an dem sie spielen. In fast allen Fällen haben sie bloß eine abgekürzte Ortsangabe oder gar keine. Wenn die Orte genannt werden, ist es gewöhnlich, weil sie eine besondere Bedeutung für die Unterweisung haben. Daher scheint es sicher, dass der Ort hier eine Rolle spielt. Vielleicht soll er eine Verbindung zur ersten Lehrrede herstellen. Und vielleicht soll er nahelegen, dass dies das erste Jātaka ist …
Nicht nur ist dies das erste Sutta im Aṅguttara, das vom Buddha gesprochen wurde und eine richtige Ortsangabe enthält, es ist auch die erste Geschichte, die vom Buddha im Aṅguttara erzählt wird.
Anders als die späteren Jātakas und die meisten der umfangreicheren Suttas hat dieses keine ABA-Struktur. Vielmehr wird die Geschichte erzählt und dann die Moral herausgearbeitet. Auch das ist wieder an sich nichts Spektakuläres, aber es weist, wenn auch schwach, auf das Fehlen einer systematischen Bearbeitung hin.
Der König unterhält sich auf recht vertraute Art mit seinem Wagenbauer. Das klingt nicht nach einem prunkvollen Monarchen der Moriya-Ära, noch nach einem legendären König aus alten Tagen. Es klingt nach einem kleinen Herrlein eines eher kleinen Garnisonsstädtchens. Die Vorbereitungen für den Krieg sind, vorsichtig ausgedrückt, nachlässig: ein Streitwagen! Natürlich sind die Dinge in gewisser Weise auch heute nicht anders: Die Rüstungsverträge werden immer noch nicht rechtzeitig erfüllt …
Als das Rad vorwärts gerollt wird, spricht der Text davon, dass ihm „Schwung“ zum Rollen gegeben wird. Das ist im Pali abhisaṅkhāra. Dieser Begriff wird in den Palitexten sonst eher in einem verfeinerten, abstrakten Sinn gefunden, wo er gleichbedeutend mit cetanā oder Absicht ist; tatsächlich wird er tendenziell in mehr technischen Diskussionen von Kamma und Ähnlichem gebraucht. Hier erscheint er in seiner einfacheren, älteren, physischen Bedeutung. Ich frage mich, ob es eine Verbindung zum Namen des Königs gibt: Pacetana – vielleicht „der, dessen Wille getan wird“?
In ähnlicher Weise benutzt der Text, wenn die Fehler des Rades beschrieben werden, Begriffe in einer physischen Bedeutung, die im Pali öfter in einem psychologischen Sinn zu finden sind: savaṅkā sadosā sakasāvā. Auch kusala findet sich in seiner älteren Bedeutung „geschickt“ statt der bekannteren ethischen Bedeutung.
Als ein weiteres ungewöhnliches Merkmal sagt der Buddha, als er die Moral aus der Geschichte zieht, dass „alle Bhikkhus und alle Bhikkhunis“, wenn sie bei sich Fehler sehen, diese aufgeben sollen. Dass auf diese Art Bhikkhunis ausdrücklich eingeschlossen werden, ist in den Palitexten sehr ungewöhnlich; eine schnelle Suche bringt nur vier oder fünf ähnliche Fälle zum Vorschein. Nennen Sie mich voreingenommen, aber ich habe den Verdacht, dass die Redakteure des Palikanon, entweder zufällig oder mit Absicht, die Bhikkhunis generell ausgeschlossen haben. Das Satipaṭṭhānasutta zum Beispiel erwähnt die Bhikkhunis in der Sarvāstivāda-Version, nicht aber in der Paliversion. Wenn ich hier richtig liege, ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass dieses Sutta ein frühes ist und wesentlichen redaktionellen Änderungen entgangen ist.
Der Text hält sich an das „Prinzip der zunehmenden Silbenzahl“. Das heißt, dass in verschiedenen Begriffsreihen die Wörter mit der höheren Silbenzahl weiter hinten stehen, wie etwa in dem Satz, den ich weiter oben zitiert habe: savaṅkā sadosā sakasāvā. Von Mark Allon wurde ausführlich nachgewiesen, dass das ein herausragendes Stilmerkmal der frühen Palitexte ist und ein Hinweis auf ihren Ursprung in einer mündlichen Kultur.
Vielleicht das bedeutsamste Merkmal von allen ist die Art, wie der Text Zahlen verwendet. Gerade wie das Dhammacakkappavattana-Sutta ist der Text sorgfältig um eine Gruppe von Zahlen herum aufgebaut, die auf subtile Art ineinandergreifen. Wo das Dhammacakkappavattana-Sutta „zwei Extreme“, den „achtfachen Pfad“ und die „vier edlen Wahrheiten“ aus „drei Blickwinkeln“ mit insgesamt „zwölf Aspekten“ beschreibt, hat das Pacetanasutta die zwei Räder, jedes aus drei Teilen bestehend, von denen jeder drei mögliche Fehler hat. Diese sollen in sechs Monaten fertiggestellt werden, aber sechs Tage vor Ablauf der sechs Monate ist nur eins fertig; und das zweite Werk von minderer Qualität ist in sechs Tagen fertig. Die drei Teile jedes Rades entsprechen den drei Schulungen, von denen jede ebenfalls drei mögliche Fehler hat. Obwohl der Text diese Verbindung nicht ausdrücklich herausarbeitet, scheint folgendermaßen eine Parallele impliziert zu sein: Felge = Körper, Speichen = Sprache und Nabe = Geist. Diese Art des Gebrauchs von Zahlen kann man aus einer Reihe von Blickwinkeln betrachten. Aber was dieser Text uns in seinem Kern sagt: dass sorgfältige Handwerkskunst ein haltbares, stabiles Rad produziert. Und die Haltbarkeit und Stabilität des Rades des Dhamma war tatsächlich eins der Hauptanliegen der frühen Buddhisten. Ich vermute, unser Sutta will uns und vielleicht den frühen Generationen der Redakteure sagen, dass gut aufgebaute, formal symmetrische Texte, die mnemonische Hilfsmittel wie ineinandergreifende Zahlen benutzen, um einprägsame Strukturen zu schaffen, den Schlüssel zur Bewahrung des Dhamma darstellen.