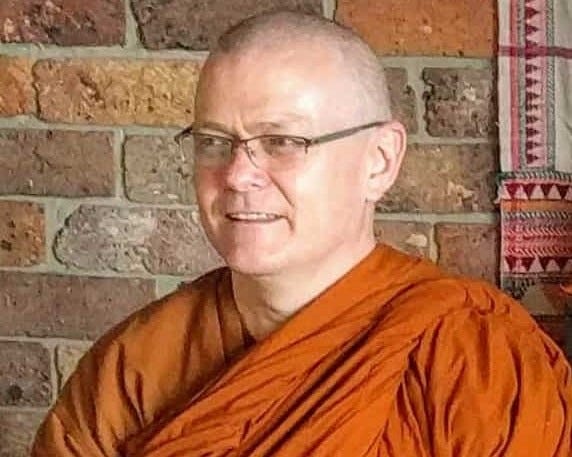Vāri und die Zügelung Mahāvīras
Übersetzung von „On vāri and the restraint of Mahāvīra“ von Bhikkhu Sujato, 2023
DN 2 gibt eine wichtige Übersicht über die Hauptlehren einiger Zeitgenossen des Buddha, darunter auch Mahāvīra Vardhamāna, der „Jaina-Asket aus dem Stamm Ñātika“, wie er in den Palitexten genannt wird.
Die Pali-Passage war für viele Übersetzer ein Kampf, da sie linguistisch unklar ist und sich nicht offensichtlich auf andere bekannte Lehren der Jainas bezieht, wie sie im Palikanon überliefert sind. Die Passage findet sich in DN 2:29.4 und in MN 56:12.2.
sabbavārivārito sabbavāriyutto sabbavāridhuto sabbavāriphuṭo
Wir wollen sehen, ob wir das mithilfe von Jaina-Schriften entwirren können.
Es heißt, das sei eine „vierfache Beschränkung“. Es gibt eine bekanntere vierfache Beschränkung in DN 25:16.3, die mit der bekannten Reihe dieses Namens im Jainismus übereinstimmt. Daher entstand der Verdacht, die Lehre hier könnte verfälscht sein oder vielleicht eine Satire auf Ansichten der Jainas darstellen. Da vāri im Pali „Wasser“ bedeutet, und da die Jainas durch ihre Regeln in Bezug auf Wasser auffielen (siehe MN 56:11.2, wo udaka gebraucht wird), nahmen manche Übersetzer, mich selbst eingeschlossen, dies als Hinweis auf den Umgang der Jainas mit Wasser.
Es stellt sich allerdings heraus, dass die Stelle eine enge Parallele in einem authentischen frühen Jainatext hat, der die Lehren Mahāvīras selbst aufzeichnet. Nicht nur das, sondern fast der gesamte Abschnitt hat enge Parallelen in den Suttas.
Der Text ist das Isibhāsiyāiṁ, die „Sprüche der Seher“. Das ist ein recht außergewöhnlicher Text, der Sprüche von vielleicht vierzig Weisen aufzeichnet, von denen die meisten keine Jainas zu sein scheinen. Manche sind Buddhisten – einschließlich Sāriputta; ich hoffe, dass ich mir seine Strophen in der Zukunft anschauen kann –, manche sind Brahmanen, und andere haben keine bekannte Zuordnung.
Text hier:
https://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/2_prakrt/isibhasu.htm
Übersetzung [englisch; A.d.Ü.] und Studie hier:
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.322298/page/7/mode/2up
Der in Frage stehende Abschnitt, Kapitel 29, hat eine Reihe von Strophen, die Vaddhamāṇa zugeschrieben sind, der seltsamerweise in der Jainatradition nicht mit ihrem Lehrer Mahāvīra Vardhamāna, sondern mit einem anderen Weisen identifiziert wird. Das scheint jedoch falsch zu sein, nicht zuletzt, weil ihm die gleiche Lehre auch im Pali zugeschrieben wird. Daher können wir annehmen, dass dies tatsächlich Mahāvīra zugeschrieben wurde.
Vor dem Hintergrund der engen buddhistischen Parallelen, die der ganze Text hat, liegt es nahe, sich zu fragen, welche Beziehung zwischen beiden besteht. Vielleicht entlehnten die Buddhisten von den Jainas oder umgekehrt oder beides, oder beide griffen auf die gleiche Quelle zurück, oder beide hatten die gleichen Lehren, bevor sie sich in zwei Traditionen aufspalteten (dies nimmt an, dass die frühe buddhistische Tradition weniger differenziert war als sie es später wurde). Alle oder keine dieser Möglichkeiten könnten zutreffen, und ich bin mit den Texten nicht vertraut genug, um verlässliche Schlussfolgerungen zu ziehen.
Ich werde den Jainatext hier vorstellen, aber da sich Vieles wiederholt, werde ich ihn abkürzen. Ich gebe eine grobe Übersetzung, aber da ich Ardhamagadhi nicht beherrsche, nehmen Sie es bitte mit Vorbehalt. Über den Text gibt es eine gute Studie mit Übersetzung; die Übersetzung ist sehr frei, aber dennoch hilfreich. Paliparallelen sind mit aufgenommen. [Deutsche Übersetzung hier nach Bhikkhu Sujatos englischer; A.d.Ü.]
savanti savvato sotā, | kiṃ -a sotoṇṇivāraṇaṃ? /
puṭhe muṇī āikkhe: | kahaṃ soto pihijjati? ||1||
Die Ströme fließen überallhin, was ist ihre Blockade?
Ich stelle dem Abgeklärten diese Frage: Wie werden die Ströme eingedämmt?
“Savanti sabbadhi sotā,
(iccāyasmā ajito)
Sotānaṁ kiṁ nivāraṇaṁ;
Sotānaṁ saṁvaraṁ brūhi,
Kena sotā pidhiyyare”.
Beachte, dass das Verb pihijjati / pidhiyyare ausgesprochen selten ist, dies ist sein einziges Vorkommen im Palikanon.
Sowohl im buddhistischen als auch im Jainatext erhält diese einleitende Frage eine gute und angemessene Antwort, aber beide sind vollkommen verschieden.
vaddhamāṇeṇa arahatā isiṇā buitam. ||1||
Der vollendete Seher Vardhamāna sagte:
panca jāgarao suttā, | panca suttassa jāgarā /
pancahiṃ rayam ādiyati, | pancahiṃ ca rayaṃ ṭhae ||2||
Fünf schlafen unter den Wachen, fünf wachen unter den Schlafenden
Von fünf wird Staub gesammelt, von fünf Staub abgewendet.
“Pañca jāgarataṁ suttā,
pañca suttesu jāgarā;
Pañcabhi rajamādeti,
pañcabhi parisujjhatī”ti.
Der Palikommentar erklärt die Fünf als die fünf Hindernisse und die fünf spirituellen Fähigkeiten, während sich der Jainatext auf die fünf Sinne bezieht, die bei den Erleuchteten „schlafend“ (inaktiv) sind, aber „wach“ (zügellos) bei den Toren.
Als Nächstes geht der Jainatext dazu über, jeden der fünf Sinne zu besprechen, in Strophen, die lose an SN 35.94 erinnern. Die Parallele ist nicht so eng wie bei den beiden vorigen Strophen, aber der allgemeine Tenor ist der gleiche. Der Jainatext beginnt aus irgendeinem Grund mit dem Ohr und wiederholt die fünf Sinne in genau der gleichen Form. Der Palitext auf der anderen Seite hat die übliche Reihenfolge und führt in jeder Strophe Variationen ein. Ich werde nicht alle wiedergeben, das Auge soll genügen.
rūvaṃ cakkhum uvādāya | maṇuṇṇaṃ vā vi pāvagaṃ /
maṇuṇṇammi -a rajjejjā, | -a padussejjā hi pāvae ||5||
maṇuṇṇammi arajjante | aduṭhe iyarammi ya /
asutte avirodhīṇaṃ | evaṃ soe pihijjati ||6||
Wenn im Auge ein Bild entsteht, erfreulich oder schlecht,
verlange nicht nach dem Erfreulichen, noch wehre das Schlechte ab.
Das Erfreuliche nicht verlangen, das Unerwünschte nicht abwehren,
ohne zu haften, ohne zurückzuweisen: So wird der Strom eingedämmt.
Disvāna rūpāni manoramāni,
Athopi disvāna amanoramāni;
Manorame rāgapathaṁ vinodaye,
Na cāppiyaṁ meti manaṁ padosaye.
Wenn du angenehme Bilder gesehen hast
und auch unangenehme,
mach dich von allem Begehren nach Angenehmem los,
ohne zu hassen, was du nicht magst.
Beachte, dass das Ardhamagadhi-Wort maṇuṇṇaṃ an Stelle des Paliworts manorama steht. Beide haben die gleiche Bedeutung und sind von man („Geist“) abgeleitet. Die genauere Palientsprechung ist manuññaṁ, das man selten findet (z. B. in MN 66:11.3). Es ist interessant, dass manuññaṁ im Isibhāsiyāiṁ nur hier und in den Sāriputta zugeschriebenen Strophen vorkommt, wo es tatsächlich eine enge Übereinstimmung mit der Passage in MN 66:11.3 darstellt.
Über die Bedeutung von asutte in der letzten Zeile der Jaina-Strophe bin ich mir nicht sicher. Es scheint, es bedeutet „nicht schlafend“ wie in dem Gedicht weiter oben. Aber der Sinn verlangt vielmehr „nicht haftend, ohne zu bevorzugen“; in ähnlichen Passagen hat das Pali ananurodha („ohne zu bevorzugen“). Vielleicht ist es eine Form von asatta, „nicht haftend“.
Die nächste Reihe von Strophen scheint keine nahen Pali-Äquivalente zu haben, obwohl es einige gemeinsamen Wendungen gibt, die mir auffallen, aber das ist sicher nicht alles. Ein merkwürdiges Detail ist allerdings, dass der Prosarahmen von SN 35.94 vom „Gezähmten“ und „Ungezähmten“ spricht, gerade wie diese Strophen. Somit sprechen die obengenannten Strophen von Zügelung durch die Sinne und haben das mehr oder weniger mit denen in SN 35.94 gemeinsam. Beide Male sind die Strophen in einen Kontext eingebettet, der verschieden ist, aber der Kontext – Prosa in einem Fall, Strophen im anderen – führt das Konzept des „Gezähmten“ ein.
Ich gebe eine sehr grobe Übersetzung, die ich großenteils ohne Satzzeichen belasse, um zu zeigen, wie unsicher sie ist.
duddantā indiyā panca | saṃsārāya sarīriṇaṃ /
te c’ eva -iyamiyā sammaṃ | -evvāṇāya bhavanti hi ||13||
wenn die fünf Sinne schlecht gezähmt sind, wandert man im Umherwandern umher
sobald sie gezügelt sind, dienen sie als Werkzeug für die Befreiungduddanteh’ indieh’ appā | duppahaṃ hīrae balā /
duddantehiṃ turaṃgehiṃ | sārahī vā mahā-pahe ||14||
ungezügelte Sinne treiben die Seele hinab in die Hölle
so wie wilde Rosse den Wagen von der Straße ziehenindiehiṃ sudantehiṃ | -a saṃcarati goyaraṃ /
vidheyehiṃ turaṃgehiṃ | sārahi vvāva saṃjue ||15||
wenn die fünf Sinne gut gezähmt sind, schreitet man in diesem Bereich fort
so wie geschulte Rosse auf der Straße bleibenpuvvaṃ maṇaṃ jiṇittāṇaṃ | vāre visaya-goyaraṃ /
vidheyaṃ gayam ārūḍho | sūro vā gahit’ āyudho ||16||
zuerst bezwinge den Geist, zügele ihn in dem Hoheitsgebiet
reite und befehlige den Elefanten wie ein Krieger in Rüstungjittā maṇaṃ kasāe yā | jo sammaṃ kurute tavaṃ /
saṃdippate sa suddh’ appā | aggī vā havisāhute ||17||
wer Geist und Befleckungen bezwungen hat und richtig Askese übt
leuchtet hell wie das Feuer auf einem Altar voller Opfergabensammattaṇṇirataṃ dhīraṃ | danta-kohaṃ jitindiyaṃ /
devā vi taṃ -amaṃsanti | mokkhe c’ eva parāyaṇaṃ ||18||
der Bedächtige, der richtig geleitet ist, gezähmt, Sieger über die Sinne
wird selbst von den Göttern gepriesen, Freiheit ist seine Bestimmung
Ein paar Pali-Parallelen:
AN 4.28:7.5: Devāpi naṁ pasaṁsanti,
Snp 5.15:3.5: Vimuttaṁ tapparāyaṇaṁ.
savvattha viraye dante | savva-vārīhiṃ vārie /
savva-dukkha-ppahīṇe ya | siddhe bhavati -īraye ||19||
Einer, der allseits wunschlos ist, gezähmt, in allen Zügelungen gezügelt
der sich von allem Leiden freigemacht hat, wandert und erzielt Erfolg
Beachte dhīra in der vorangehenden Strophe (18), auch in den folgenden:
Pli-tv-kd1/de/maitrimurti-traetow#mt14-169: Yo dhīro sabbadhi danto
Der Bedächtige, allseits gezähmt
Snp 2.2:12.3: Saṅgātigo sabbadukkhappahīno, Na lippati diṭṭhasutesu dhīro”.
Der Bedächtige ist seinen Schlingen entschlüpft und hat alles Leiden aufgegeben; er hängt nicht an Gesehenem und Gehörtem.
Der Punkt, der uns hier am meisten interessiert, ist die letzte Strophe (19), wo wir savva-vārīhiṃ vārie finden, das offensichtlich die gleiche Bedeutung hat wie die Paliwendung sabbavārivārito.
Der Jainatext hat nur diese eine Wendung, nicht die vier. Die „vier Beschränkungen“ sind im Jainismus normalerweise ethische Regeln, beginnend damit, nicht zu töten, und diese Bedeutung findet man in der Tat bei Isibhāsiyāiṁ 31.39 ff. Sehr wahrscheinlich wird dieses vierfache Schema hier als Strophe zusammengefasst.
Der jainistische Kontext reicht aus, um einen Zusammenhang zwischen vāri hier und „Wasser“ eindeutig auszuschließen. Es ist vielmehr eine Kausativ-Form, „zum Halten bringen“, d. h. „zügeln“. Diese Bedeutung wird in der ersten Strophe des Gedichts eingeführt und im Verlauf durchgängig bekräftigt.
Die Form vārīhiṃ ist, so glaube ich, ein Lokativ Plural, im Gegensatz zum Palikommentar, der mit Instrumental erklärt. Die Paliform ist mehrdeutig und zusammengesetzt, aber solche Variationen bei indirekten Formen sind nichts Ungewöhnliches.
Kommen wir zuletzt mit ein paar Bemerkungen auf die Palipassage zurück:
Dhuta im Sinn von „abgeschüttelt (Böses mithilfe asketischer Praktiken)“ ist ein typischer Jaina-Ausdruck.
Zu sabbavāriphuṭo vergleiche ophuṭo in MN 99:15.5. In beiden Fällen erscheint phuṭ in einer Kette von Begriffen aus der Wurzel var und ist möglicherweise eine verfälschte Form oder hat zumindest die gleiche Bedeutung.
Daher können wir übersetzen:
sabbavārivārito sabbavāriyutto sabbavāridhuto sabbavāriphuṭo
(Ein Jaina-Asket) ist in allen Zügelungen gezügelt, in allen Zügelungen im Zaum gehalten, hat in allen Zügelungen das Böse abgeschüttelt und hat sich in allen Zügelungen Einhalt geboten.
[A.d.Ü.]: Inzwischen lautet die Übersetzung:
It’s when a Jain ascetic is restrained in all that is to be restrained, is bridled in all that is to be restrained, has shaken off evil in all that is to be restrained, and is curbed in all that is to be restrained.
Da ist ein Jaina-Asket in allem, was zu zügeln ist, gezügelt, in allem, was zu zügeln ist, im Zaum gehalten, hat in allem, was zu zügeln ist, das Böse abgeschüttelt und und hat sich in allem, was zu zügeln ist, Einhalt geboten.