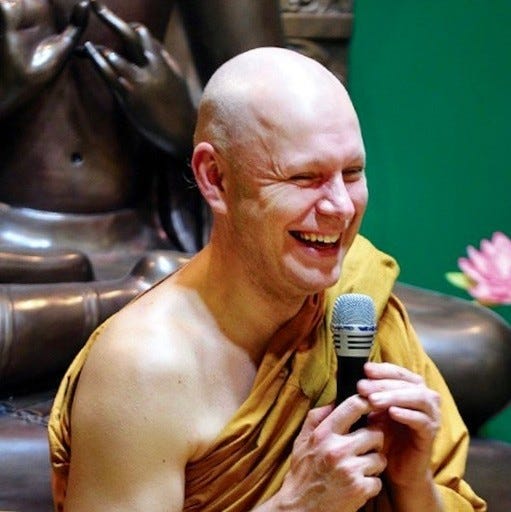Ein pāsāda ist eine bestimmte Art von Gebäude, aber worum genau es sich handelt, wurde nie richtig untersucht. Das mag nach einem wenig verheißungsvollen Thema für einen kurzen Essay klingen, doch es ist erstaunlich, wie kleine Dinge manchmal bedeutsame Auswirkungen haben können.
Pāsāda wird normalerweise mit „Palast“ übersetzt, manchmal mit „Villa“. Abgesehen von der phonetischen Ähnlichkeit zwischen pāsāda und „Palast“, die keinerlei linguistische Bedeutung zu haben scheint, stützt sich das, so scheint es, hauptsächlich auf Erläuterungen der Kommentare. Selbst ein recht kursorischer Blick auf die kanonischen Texte zeigt uns aber, dass es für diese Übersetzungen keine wirkliche Grundlage gibt.
Werfen wir einen kurzen Blick auf ein paar kommentarielle Beschreibungen. In AN 3.39 heißt es über den künftigen Buddha, bevor er das Hausleben aufgegeben habe, habe er drei pāsādas gehabt, eins für jede der indischen Jahreszeiten. Laut Kommentar waren diese jeweils neun, sieben und fünf Stockwerke hoch. Ein berühmtes pāsāda war das, das dem Saṅgha in Sāvatthī von Visākha gespendet wurde. Nach dem Kommentar war dieses sieben Stockwerke hoch. Alles hohe Gebäude!
Es fällt schwer, diese Beschreibungen der Kommentare ernst zu nehmen. Es gibt in den vier Nikāyas keine eindeutige Erwähnung von mehrstöckigen Gebäuden, mit Ausnahme von einem gelegentlichen Bezug auf ein einzelnes Obergeschoss oder einen Dachboden, etwa in bestimmten kuṭis. Darüber hinaus legen die archäologischen Zeugnisse aus der Zeit nahe, dass die Städte eine moderate Größe hatten, selbst große wie Sāvatthī. Wissenschaftliche Größenschätzungen für die größten Städte belaufen sich typischerweise auf einige Tausend Einwohner, vielleicht einige Zehntausend. Es erscheint unwahrscheinlich, dass diese genügend materielle Ressourcen und Vermögen hatten, um sehr große oder hohe Bauwerke zu errichten. Noch bedeutsamer ist die Tatsache, dass alle Gebäude aus vergänglichen Materialien gefertigt waren – das ist der Grund, dass es keine materiellen Überreste aus der Zeit gibt, mit Ausnahme von Erdwällen, Stadtmauern oder Ähnlichem. Wiederum erscheint es unwahrscheinlich, dass sehr große Gebäude, und besonders sehr hohe, aus Holz gebaut worden sein sollten. Alle archäologischen Daten aus der Gangesebene für den entsprechenden Zeitraum sprechen für kleinformatige Gebäude.
Wenn also die Vorstellungen des Kommentars Fantasievorstellungen sind, was sind dann diese pāsādas? Ein guter Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass pāsādas vom Buddha für Mönche und Nonnen erlaubt wurden. Nun ist einer der wichtigsten Grundsätze des Vinaya, dass Mönche und Nonnen nicht in Luxus leben sollen. Allein auf dieser Grundlage können wir den Schluss ziehen, dass pāsādas im Allgemeinen nicht luxuriös waren. Das schließt „Palast“ und „Villa“ als geeignete Übersetzungen von vorneherein aus.
Ein anderer Punkt über pāsādas, der auffällt, ist, dass man immer auf sie hinauf- oder von ihnen herabsteigt. Das heißt, sie müssen vergleichsweise hohe Bauwerke gewesen sein. Es ist interessant, dass die Suttas keine andere Art erwähnen, wie man diese Gebäude betritt – außer hinauf- und herabsteigen –, was bedeuten muss, dass sie vom Boden aus nicht direkt zugänglich sind. Sie müssen auf einer Art erhöhtem Fundament gebaut worden sein. Eine Stelle aus SN 3.21 ist besonders aufschlussreich:
… wie jemand, der vom Boden auf eine Liege steigt; von einer Liege auf ein Pferd; von einem Pferd auf einen Elefanten; und von einem Elefanten auf ein pāsāda …
Gemäß einer Reihe von Passagen hatten pāsādas außen liegende Treppen (sopānakaḷevara, MN 85) oder Leitern (nisseṇi, DN 9 und DN 13), auch das pāsāda, das dem Saṅgha von Visākha gegeben worden war (MN 107), und es scheint, wie wurden immer über diese betreten. Gleichnisse in DN 9 und DN 13 sprechen davon, eine Leiter zu bauen, bevor ein hypothetisches pāsāda gebaut wird. Diese Gleichnisse scheinen nahezulegen, dass alle pāsādas durch Steigen erreicht werden. Außerdem zeigt der Gebrauch des Wortes „Leiter“, dass pāsādas oft recht bescheidene Gebäude waren.
Die Notwendigkeit des Steigens, um Zugang zu bekommen, scheint auch der Grund zu sein, dass der Ehrwürdige Pilindavaccha – in einer der Fallgeschichten zu Pārājika zwei – von einem pāsāda Gebrauch machen konnte, um ein paar Kinder vor Entführern zu verstecken. Wenn pāsādas hoch über dem Boden waren und die Leiter für den Zugang wurde weggenommen, waren die Kinder vermutlich sicher. Wir finden auch das recht gebräuchliche zusammengesetzte Wort uparipāsāda, „oben auf dem pāsāda“, was zu dieser Beschreibung passt. Keine anderen Namen für Bauwerke sind in dieser Art mit upari zusammengesetzt.
Der abschließende Schlüssel zur Bedeutung von pāsāda ist, dass es darunter offenbar freien Platz gab. In der oben erwähnten Passage aus AN 3.39, wo der Buddha von seinem Leben vor dem Fortziehen spricht, heißt es, er sei während der gesamten vier Monate der Regenzeit im Regenzeit-pāsāda geblieben, ohne heṭṭhāpāsādaṃ orohati. Orohati bedeutet „steigt herab“ und heṭṭhā bedeutet „unter“. Heṭṭhā wird in anderen zusammengesetzten Wörtern gebraucht wie heṭṭhāmañcaṃ, was unzweideutig „unter dem Bett (mañca)“ bedeutet. Daraus folgt, dass heṭṭhāpāsādaṃ orohati nur „steigt unter das pāsāda herab“ bedeuten kann, was bedeutet, dass es unter pāsādas einen offenen Raum gegeben haben muss. Meine Schlussfolgerung ist demnach, dass sich pāsāda wahrscheinlich auf einen Pfahlbau bezieht.
Nun ist ein Pfahlbau gegenüber einem Palast ein vergleichsweise bescheidenes Bauwerk. Aber es erscheint mir wahrscheinlich, dass sie in der Situation des alten Indien beträchtliche Vorteile hatten und daher vermutlich als hochwertige Häuser betrachtet wurden. In einem Klima, in dem es häufig starken Regen und Überschwemmungen gab, werden Pfahlbauten besonders gesucht gewesen sein. Es ist auch möglich, wie die Geschichte mit dem Ehrwürdigen Pilindavaccha zeigt, dass diese Häuser als vergleichsweise sicher vor Einbrechern und Ähnlichem galten.
Wir müssen noch ein paar Passagen in den Suttas in Betracht ziehen, in denen sich pāsāda eindeutig auf einen „Palast“ bezieht, wie etwa Sakkas Palast in MN 37 und Mahāsudassanas Paläste in DN 17. In diesen beiden Fällen waren die pāsādas prachtvolle Bauwerke, und selbst das Wort „Palast“ mag ihrer Herrlichkeit nicht voll gerecht werden. Zugleich bezieht sich keiner dieser Erzählrahmen auf das historische Indien, und man betrachtet sie vielleicht am besten als mythologisch. Eine mögliche Erklärung für den Gebrauch von pāsāda in diesen Fällen ist, dass man kein anderes passendes Wort hatte. Pāsādas waren vielleicht die besten Häuser, die es zu der Zeit gab, und somit wurden sie benutzt, um jede Art von schönem Haus zu beschreiben, sogar gewaltige Bilder der Fantasie.
Hat all das irgendeine Bedeutung? Es vermittelt uns ein realistischeres Bild vom Leben des künftigen Buddha, ein Bild, das besser zu den bekannten Fakten wie etwa archäologischen Funden passt. Es ist so schwer, sich dem Griff der nachkanonischen Übertreibungen und der Neigung, den Buddha auf überzogene Art zu verherrlichen, zu entziehen. Solche Verherrlichung führt dazu, uns vom historischen Buddha zu entfernen und ihn zu einer fiktiven Figur zu machen. Sobald der Buddha fiktiv und unrealistisch dargestellt wird, wird es viel schwieriger, sich mit ihm als Menschen zu identifizieren, und seine Vorbildfunktion für uns wird dadurch geschwächt. Um den größtmöglichen Gewinn aus den Lehren des Buddha ziehen zu können, ist es wichtig, denke ich, dass wir von ihm ein möglichst realistisches Bild haben. „Pfahlbau“ anstelle von „Palast“ ist ein kleiner, doch nicht unbedeutender Beitrag zu diesem Ziel.