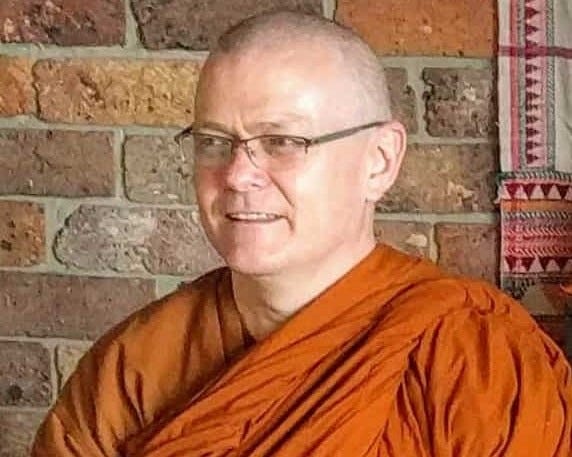Zum Originaltext; der Essay bezieht sich auf diesen vorausgegangenen Diskussionsbeitrag
In der Umgangssprache ist „Mythos“ etwas, das falsch ist, aber häufig für wahr gehalten wird. Aber das ist recht weit von der ursprünglichen Bedeutung, „eine sakrale Geschichte“, entfernt.
Wenn man die genannten Beispiele betrachtet, so hat die Frage, ob es sich dabei um Mythen handelt oder nicht, nichts damit zu tun, ob die Wesen oder die außerordentlichen Vorgänge tatsächlich existierten oder stattfanden. Geschichten, die vollkommen erdgebunden sind (wenn man so will), können Mythen sein, obwohl es auch stimmt, dass darin gewöhnlich außerordentliche Elemente zu finden sind, um anzudeuten, dass die Ereignisse über die gewöhnlichen Vorstellungen von Raum und Zeit hinausgehen. Was etwas zum Mythos macht, ist vielmehr, dass es eine Geschichte ist, die eine Art transzendente oder gemeinschaftsbildende Bedeutung besonders innerhalb einer Gruppe beinhaltet.
In diesem Sinn wäre die Geschichte vom Leben des Buddha immer noch ein Mythos, selbst wenn wir alle sogenannten „übernatürlichen“ Elemente daraus entfernen würden (und sie würde immer noch die Stadien des klassischen Heldenmythos verkörpern). Wunder und Magie machen sie einfach unterhaltsamer, wie Computeranimation in einem Film. Aber sie haben keinen Einfluss auf die Bedeutung des Mythos – im Unterschied etwa zu der Geschichte von Jesus, in der die Auferstehung für den Mythos wesentlich ist.
Zu den Punkten im Einzelnen: Einige davon, wie etwa Punkt 3, sind Elemente in einer mythischen Geschichte. Die von Wundern begleitete Geburt ist ein wesentliches Element im Heldenmythos.
Die Behauptungen des Mahāyāna machen das aus, was ich als eine sektenbezogene Mythologie betrachte. Ich habe das in meinem Buch „Sekten und Sektenwesen“ (Sects & Sectarianism) diskutiert, wenngleich hauptsächlich im Zusammenhang mit den frühen Schulen und nicht dem Mahāyāna. Im Wesentlichen ist das eine Art früher Propaganda, Geschichten, die zu Marketingzwecken erfunden wurden, die bewusst Form und Motive der klassischen Mythologie annehmen, um der jeweiligen Schule Autorität zu verleihen. Keine davon ist wahr, wenn das deine Frage war.
Aber das alles ist, und ich hoffe, du verzeihst mir das, belanglos. Nichts davon berührt das Herz der Angelegenheit, das da lautet: Warum ist Mythos bedeutsam? Warum haben solche Geschichten so große Wirkung auf uns?
Der wahre Mythos geht zu einem tieferen Ort im Bewusstsein und in der menschlichen Gesellschaft zurück. Er wird nicht bewusst gebildet, er entwickelt sich und wächst. Mythen sind Geschichten, die über Jahrhunderte und Jahrtausende immer und immer wieder erzählt werden, bis sie nicht mehr die Geschichte eines bestimmten Menschen sind, sondern universell werden. Sie beginnen nicht in der Absicht, irgendetwas zu sein, sie wachsen vielmehr in ihre eigene Bedeutung hinein. Weil ihre Anfänge im Dunkel der Zeit verloren sind, hört man sie nie zum ersten Mal; sie sind Teil des Gewebes einer Kultur, stets gegenwärtig, und durchdringen diese als Geschichte, Ritual, Bild, und sie sind in die Grundlagen der Sprache eingebettet.
Tolkien wusste das, weshalb er zuerst Sprache erschuf, dann fand er Geschichten, die in diesen Sprachen erzählt wurden. Warum ist es so ein emotional bewegender und machtvoller Augenblick, wenn Leute zum Beispiel sehen, wie Aragorn zum König gemacht wird – aber wir glauben an die Demokratie? Mythos berührt etwas Tieferes, Ursprünglicheres als das, was wir mit unserem rationalen Geist erreichen können.
Die grundlegende Form des Mythos ist die Schöpfungsgeschichte. Zum Ursprung: dahin führen alle Mythen. Nun, zum Teil tun sie das, weil sie als Geschichten, die über zahllose Generationen wieder und wieder erzählt werden, tatsächlich zutreffende Informationen über die Vergangenheit bewahren. Aber auf einer tieferen Ebene erzählen sie von einer urzeitlichen Vergangenheit, die noch heute lebendig ist. Als Geschichten halten sie die Vergangenheit lebendig; und die bloße Tatsache, dass sie immer noch erzählt werden, sagt uns, dass sie noch heute etwas für uns bedeuten. Die Gegenwart wiederholt die Muster und Probleme der Vergangenheit; mythische Zeit ist zyklische Zeit, weshalb die Mythen „nie waren, aber immer sind“.
Wenn die grundlegende Form des Mythos die Schöpfungsgeschichte ist, so ist das grundlegende Motiv der Tod Gottes. Nehmen wir die Bibel. Wir sind gewohnt, sie als die Geschichte der Worte und Taten Gottes anzusehen. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten, war Gott „am Anfang“ bereits da. Doch mit jedem Schritt auf dem Weg tritt er weiter von der Handlung zurück. Im Garten Eden bleibt er im Hintergrund. Bald kann man ihn nur noch in Gewitterwolken oder einem vorüberhuschenden Schatten sehen oder in bizarren und verzerrten Formen. Dann kann man ihn gar nicht mehr sehen: Er muss seinen Sohn senden. Der wiederum geht weg und, anders als versprochen, kommt nicht wieder. Nun bleibt uns nur noch ein Stück getrocknetes Brot übrig. Die Bibel ist die Geschichte vom Tod Gottes.
Doch das ist nur ein Beispiel. In Ägypten, Griechenland, Indien, Persien, überall sehen wir das Gleiche. Und nicht nur das, wir sehen das Gleiche bereits vom ersten Anfang an. Der älteste Mythos, den wir haben – Gilgamesch –, enthält bereits Erinnerungen an ältere Mythen und Betrachtungen darüber, wie Götter betrogen und sich zurückgezogen haben.
Das ist natürlich ein übergreifendes Thema buddhistischer Texte. Sie sind zwar typischerweise sanfter in der Herangehensweise – wir nageln unsere alten Götter nicht an Kreuze, wir machen Witze über sie –, aber der Effekt ist der Gleiche. Sobald wir den nötigen Abstand und die Ironie haben, um in der Lage zu sein, einen Witz auf Kosten Gottes zu machen, ist es mit diesem Gott vorbei. Wir verlassen uns nicht länger auf göttliches Eingreifen oder göttliche Offenbarung, um die Wahrheit oder einen Sinn zu finden, wir verlassen uns auf unsere eigene Erfahrung, unseren Verstand, unsere Erkenntnis.
Die Geschichte vom Tod Gottes ist auch die Geschichte vom Aufstieg der Menschheit. Nietzsche:
Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnfeiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen?
Der Tod Gottes ist keine moderne Erfindung. Buddhisten töteten Götter bereits vor 2.500 Jahren. Und wir waren nicht allein: Die Achsenzeit bedeutete das Ende des echten Mythos. Man kann es auch anders ausdrücken. Um große Mythen zu schaffen, benötigt eine Gesellschaft einen gewissen Grad an Entwicklung: eine ausreichende Größe, Handelsbeziehungen, Wohlstand, Stabilität und eine spezialisierte Klasse von Literaten, die über freie Zeit verfügt. Und die gleichen Faktoren, die das ermöglichen, sind auch die Faktoren, die die Ära, von der die Geschichten erzählen, zu einem Ende bringen. Der Mythos, in der Form, in der wir ihn haben, erzählt die Geschichte von seinem eigenen Tod. Das ist die Geburt der Selbstreflexion: eine Geschichte, die ihre eigene Geschichte erzählt.
Die Geschichte des Buddha ist zwar in die Form des Mythos gepackt, aber sie ist nicht mehr etwas organisch über Jahrhunderte Gewachsenes. Sie wurde bewusst und mit Absicht formuliert, erdacht von Meistern der literarischen Gestaltung. Und, ganz wichtig, sie ist nicht der Kern der Sache: Was zählt, ist der Dhamma, nicht das Leben des Buddha.
Einer der wenigen modernen Meister des Mythos, Roberto Calasso, fasste es perfekt zusammen: Der Buddha kam, um der Geste ein Ende zu bereiten. Nicht länger wurde spirituelles Leben am äußeren Ausdruck von Narrativ, Zeichen und Ritus gemessen, sondern an einem inneren Erwachen.
Der Buddhismus stellte – zusammen mit anderen Bewegungen der Zeit, die die Dinge mit Vernunft erklärten, wie dem Jainismus – die erste Generation von post-mythischen Religionen dar, die eine ähnliche Rolle innehatten wie die Philosophen in Griechenland. Von da an wurde Mythos als Mittel zum Geschichtenerzählen verwendet, wie es auch Hollywood heute tut. Er mag von Menschen genutzt werden, die seine Tiefen besser oder weniger gut erfassen, die ihn in mehr oder weniger machtvoller und tiefgründiger Weise nutzen, aber er wird bewusst genutzt und wächst nicht mehr organisch aus den Tiefen hervor. Etwas wie das Buddhacarita ist ebenso ein Vorläufer des modernen Romans, wie es ein Erbe des alten Mythos ist.
Das soll nicht heißen, dass der Mythos im Buddhismus tatsächlich tot ist; es gibt immer eine große Kluft zwischen den Einsichten der Weisen und dem Verständnis der Massen. Wenn thailändische Jungen die Entsagung des Buddha durch das Ordinationsritual wieder durchleben, hat das nichts mit einer Suche nach innerer Klarheit zu tun, sondern ist eine rituelle Verkörperung des Mythos. Der Mythos ist für viele Buddhisten sehr lebendig; und dass man sich dieser Tatsache nicht bewusst ist, liegt vielen der Spannungen zugrunde, die man im modernen Buddhismus findet.
Ich habe viele Male argumentiert, dass das Leugnen des Mythos, der chronische Mangel an Verständnis, was er ist und warum er bedeutsam ist, sich durch das moderne Studium und die Praxis des Buddhismus zieht. Man lernt mehr über Mythos, wenn man sich Krieg der Sterne anschaut, als wenn man irgendetwas liest, was von modernen buddhistischen Akademikern zu dem Thema geschrieben wurde. Wir haben das, was wahrscheinlich die umfangreichsten und ältesten Sammlungen sakraler Geschichten der ganzen Welt sind, doch sie werden regelmäßig ignoriert und nicht ernst genommen.
Das ist einer der Gründe, warum ich meinen Plan, einen vernünftigen Artikel über buddhistische Mythologie für Wikipedia zu schreiben, aufgegeben habe. Der gegenwärtige Artikel ist haarsträubend, aber er ist eine angemessene Darstellung der gegenwärtigen Erkenntnis und Forschung auf diesem Gebiet. Wikipedia stützt sich auf Zitate, und über die meisten Punkte gibt es einfach keine.
Es gibt in moderner Zeit viele reiche Quellen an Einsicht und Forschung zum Thema Mythos. Es wäre schön, zu sehen, dass die gegenwärtige verarmte Forschung im Buddhismus sich diese zunutze machen würde.