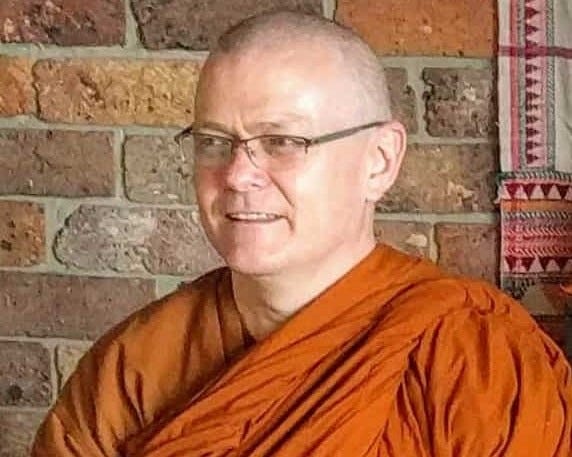Mythologie eines kulturellen Transformationsprozesses im Ghaṭīkāra-Sutta
Übersetzung von „A mythology of cultural transformation in the Ghaṭīkāra Sutta“ von Bhikkhu Sujato, 2017
Das Ghaṭīkāra-Sutta (MN 81) ist recht viel beachtet und analysiert worden. Es ist einer der sehr wenigen frühen Texte, in denen der Buddha sich ausdrücklich mit einem der Protagonisten identifiziert, somit wäre es ein kanonisches Jātaka. Zudem kommt darin ein früherer Buddha vor, Kassapa, was es noch mehr zu etwas Besonderem macht, denn es erzählt die Geschichte unseres Buddha, als er der Schüler eines früheren Buddha war.
Die Ausrichtung der meisten Interpretationen ist es, den Text durch die Brille eines naiven Realismus zu betrachten, als historisches Dokument. Aber er ist ein Mythos und sollte als solcher angesehen werden. Wenn Sie es noch nicht getan haben, möchten Sie sich vielleicht meinen früheren kleinen Aufsatz über Mythologie anschauen.
Auf D&D findet man noch weitere Quellen, wenn Sie interessiert sind. Hier will ich mich nicht bei der Theorie aufhalten, sondern einige Bemerkungen dazu anbieten, was mir aus mythologischer Sicht interessante Merkmale zu sein scheinen.
Die Geschichte der Vergangenheit ist in erster Linie als eine Spannung zwischen zwei guten Freunden aufgebaut, dem Töpfer Ghaṭīkāra und dem Vedenstudenten (māṇava) Jotipāla. Trotz ihrer Vertrautheit haben sie einen kleinen Konflikt um die Frage, ob sie den Buddha besuchen sollen. Ghaṭīkāra ist der engste Unterstützer des Buddha, aber Jotipāla lehnt den Buddha mit dem üblichen brahmanischen Spott ab und will nicht zu ihm gehen. Das ist natürlich die Weigerung, der Berufung zu folgen, ein zentrales Element des Heldenmythos.
Dennoch setzt sich Ghaṭīkāra durch. Und Jotipāla besucht schließlich nicht nur den Buddha, sondern ist so beeindruckt, dass er sogar Mönch wird.
Nun, die Geschichte eines Kampfes zwischen engen Freunden oder Brüdern ist ein fundamentales Motiv des Mythos. Im Westen werden wir sofort an Kain und Abel denken. Hier ist der Konflikt viel weniger gewalttätig – buddhistischer Mythos ist im Allgemeine sehr sanft –, aber der Grundkonflikt ist da.
Das Motiv des Konflikts zwischen Brüdern kommt durch die Rolle zustande, die der Mythos beim Erzählen von Geschichten über die Schöpfung hat. Am Anfang ist alles Eins. Aber die Welt ist vielfältig, und um diese Vielfalt zu erklären, werden Geschichten von Konflikt und Trennung erzählt. Diese Art von sekundärem Schöpfungsmythos ist sehr verbreitet und ist ein gewöhnliches Merkmal buddhistischer Mythen wie etwa des Aggañña-Sutta. Solche Geschichten dienen dazu, verschiedene Merkmale von Gesellschaft und Kultur zu erklären, wie etwa den Ursprung des Kastensystems, die Institution des Königtums, Regeln für Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen und so weiter.
In der Geschichte von Kain und Abel werden die Brüder, wie wohlbekannt ist, als ein Bauer und ein Hirt dargestellt. Somit spiegelt der Konflikt die Spaltung der Gesellschaft wieder, als die Methoden zur Nahrungsmittelproduktion differenzierter werden, was sehr unterschiedliche Lebensstile und moralische Rahmenbedingungen erfordert.
Solche Figuren sind im Mythos eine Art Kulturheld. Ein Kulturheld ist nicht unbedingt jemand, der im klassischen Sinn Ungeheuer überwindet, sondern jemand, der ein prägendes Merkmal einer bestimmten Gesellschaft einführt: eine Feldfrucht oder eine Technologie. Solche Helden können Menschen oder Götter sein oder, häufig, Halbgötter. Ein berühmtes Beispiel ist Athene, die die Olive in Athen einführte. In Ägypten wurde Osiris dafür gefeiert, das Bier einzuführen. In der indischen Tradition haben wir zum Beispiel den legendären König, der als Okkāka auf Pali oder Ikṣvaku auf Sanskrit bekannt ist, dessen ursprünglicher Ruhm wahrscheinlich darin bestand, dass er den Zucker einführte.
Um nun zu unserem Sutta zurückzukommen: Es ist interessant, dass Ghaṭīkāras Lebenserwerb so sehr betont wird. Wir erfahren eine ganze Menge darüber, wie er seine Arbeit tut, über seine ethischen Grundsätze bei der Beschaffung seiner Materialien und seine ökonomischen Richtlinien. Er lehnt es ab, für seine Arbeit Geld zu verlangen, sondern gibt seine Produkte kostenlos im Tausch gegen Lebensmittel. Trotzdem, oder vielleicht deswegen, ist er offensichtlich ein Mann von einigem Wohlstand, der es nicht nötig hat, vom König eine Gabe anzunehmen, und der aus eigenen Mitteln eine große Gemeinschaft unterhalten kann. Das legt nahe, dass seine Rolle als Töpfer einen sozialen Stellenwert hatte, der recht anders ist, als wir es uns vielleicht vorstellen.
Aber es gibt auch Dinge, die in der Übersetzung nicht so zum Ausdruck kommen. Ghaṭīkāra wird nicht nur als „Töpfer“ (kumbhakāra) beschrieben, sein Eigenname bedeutet wörtlich ebenfalls „Topf-Macher“. Somit ist er dann „der Töpfer Töpfer“ (Potter the potter). Ob er als der Urahn der berühmten Zaubererfamilie gleichen Namens anzusehen ist, will ich künftiger Forschung überlassen.
Noch interessanter ist, dass der Buddha sich auf Ghaṭīkāra mit dem Stammesnamen „Bhaggava“ bezieht. Das ist nun ein ziemlich undeutlicher Begriff. Auch an anderer Stelle in Pali- (MN 140) und Sanskrittexten (wie dem Mahābharata) wird er mit Töpfern assoziiert. Es ist ein alter und bedeutsamer Stamm in den brahmanischen Familienlinien.
Etymologisch kommt das Wort von der Wurzel bhā, was „leuchten“ oder „erhellen“ bedeutet. Es bezeichnet die Abkömmlinge von bhṛgu, die manchmal mit Venus identifiziert werden und nach dem Sanskrit-Wörterbuch Folgendes sind:
Eine mythische Rasse von Wesen, die eng mit dem Feuer verbunden sind, das sie finden und zu den Menschen bringen oder in Holz einschließen oder in den Nabel der Welt legen; oder das ihnen von mātari-śvan- gebracht und erstmals angezündet wird; sie sollen auch Streitwagen herstellen und werden zusammen mit den aṅgirasa erwähnt.
Das PTS-Wörterbuch äußert Zweifel, wieso das Wort bhaggava mit einem Stamm von Töpfern in Verbindung gebracht wird. Aber das ist wohl offensichtlich: Hochwertige Töpferwaren erfordern einen Brand. Um fortschrittliche Töpfertechniken zu entwickeln, musste der Stamm der Töpfer neue und nie dagewesenem Ausmaße der Beherrschung des Feuers erarbeiten, musste heißer und gleichmäßiger brennen als je zuvor. Zusammen mit den Metallverarbeitern sind sie die Pioniere einer Industrie. Somit bedeutet der Name bhaggava „die, die von den Ahnen die Beherrschung des Feuers ererbt haben“.
Die bhṛgu sind damit die Kulturhelden des Feuers, und das stützt unsere These, dass auch Ghaṭīkāra in diesem Licht zu sehen sein könnte. Feuer ist allerdings eine heikle Sache, und seine Beherrschung will gelernt sein. Ein Feuer zum Kochen anzuzünden, ist eine Sache; einen Brennofen für Töpferwaren zu bauen, eine andere. Wie ich bereits diskutiert habe, ist eine der wichtigsten Erfindungen, die den kulturellen Fortschritt der Gesellschaften um die Zeit des Buddha prägten, jene Art hochwertiger Luxus-Töpferwaren, die man als nördliche schwarze polierte Keramik (Northern Black Polished Ware) kennt.
Wenn Ghaṭīkāra, statt bloß ein bescheidener Handwerker zu sein, mit der Entwicklung einer neu aufkommenden bahnbrechenden Technologie wie der Herstellung der nördlichen schwarzen polierten Keramik in Verbindung gebracht wurde, würde das erklären, warum er über so viel gesellschaftliche Achtung und ökonomische Ressourcen verfügen konnte.
Aber was ist dann mit Jotipāla? Nun, er ist eindeutig als archetypischer Vertreter der alten brahmanischen Lebensweise dargestellt. Seine Kritik am Buddha als „Glatzkopf“ und „falschem Asketen“ (muṇḍaka samaṇaka) ist ein wohlvertrauter Einspruch, den wir zum Beispiel in der Kritik der Vedenstudenten von Avanti an Mahākaccāna finden; auch hier habe ich das als Indiz für eine kulturelle Veränderung ausgemacht.
Jotipāla wird ausdrücklich als Vedenstudent bezeichnet, aber sein Eigenname verrät wiederum eine weitere Nuance. Es ist einer der häufigsten Namen, die archetypischen Brahmanen in buddhistischen Texten zugewiesen sind. Ihn zu verwenden, heißt daher so viel wie zu sagen: Da war ein Schotte mit Namen McDonald. Aber es ist noch bezeichnender, denn der Name bedeutet wörtlich „Hüter der heiligen Flamme“. Die Verehrung des Feuers war natürlich grundlegend für die vedische Religion und befand sich sogar an den Wurzeln der indo-europäischen Kultur. Die Feuerverehrung war eine der Hauptpflichten der Brahmanen.
Mit den Anklängen, die diese Namen haben, zeigt sich uns der kulturelle Mythos hier als eine Geschichte, die sich um zwei unterschiedliche Haltungen zum Feuer bewegt. Für die Brahmanen war das Feuer eine heilige Kraft, ein Ausdruck der Göttlichkeit der Natur, und musste geehrt und beschwichtigt werden. Für die neue Generation war Feuer eine Energie, die dem Willen des Menschen nutzbar gemacht werden kann, um Materialien für den wirtschaftlichen Fortschritt umzugestalten.
Angesichts der charakteristisch konservativen Haltung kultureller Kräfte wie der vedischen Religion erscheint es unvermeidlich, dass solche Veränderungen nicht ohne Konflikte vor sich gingen. Denn dass die neuen Industriellen wie Ghaṭīkāra die Beherrschung des Feuers übernahmen und es ihrem Willen unterwarfen, muss wie eine unverzeihliche Sünde gegen das heilige Erbe der Brahmanen erschienen sein.
Unser Sutta bringt das sanft und in Andeutungen zum Ausdruck. Als Ghaṭīkāra Jotipāla nicht überzeugen kann, den Buddha zu besuchen, sagt er: „Gut, dann lass uns zum Fluss gehen und baden.“ Und natürlich ist auch das ein bedeutungsvoller Moment, denn auch das Baden ist eine heilige Handlung. Nachdem Jotipāla gebadet hat und dadurch spirituell geläutert und erneuert ist, geht Ghaṭīkāra so weit, dass er ihn beim Schopf packt. Das ist eine ernste Tabuhandlung, das Überschreiten einer Grenze und Eindringen in heiliges Gelände. Doch Jotipāla wird nicht zornig, sondern versteht vielmehr, dass dies Ausdruck der Ernsthaftigkeit von Ghaṭīkāras Anliegen ist. Tabubrüche, das Auflösen traditioneller Grenzen, das ist ein wesentlicher Vorläufer des Aufstiegs zu einer höheren Bewusstseinsebene. Wenn diese Grenze überschritten wird, werden die Mauern einstürzen. Und so stimmt Jotipāla dem Besuch des Buddha zu.
In dieser Geschichte hat die buddhistische Tradition die Rolle eines natürlichen Verbündeten der neuen gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Kräfte inne, die alles in der Gesellschaft verändern werden. Sie steht den alten Traditionen entgegen, dem Haften an der Vergangenheit, und ergreift Partei für das Neue, für den Fortschritt.
Aber das ist keine blinde Fortschrittsgläubigkeit. Es ist ein Leitfaden dazu, wie der Fortschritt umgesetzt werden soll, nämlich auf der Grundlage von Güte, Großzügigkeit und Fürsorge. Ghaṭīkāra mag derjenige sein, der die brahmanische Autorität herausfordert, aber er kümmert sich auch hingebungsvoll um seine alten blinden Eltern.
Obwohl uns die Auswirkungen des Töpferhandwerks auf die Umwelt unbedeutend erscheinen mögen, weist der Text sorgfältig darauf hin, dass Ghaṭīkāra es ablehnt, auch nur den Boden aufzugraben, aus Furcht, die kleinen Geschöpfe zu verletzen. Diese subtile Ethikregel, eine Gemeinsamkeit mit den buddhistischen und jainistischen Mönchsregeln, zeigt, dass wirtschaftlicher Fortschritt, obwohl an sich gut, nicht auf Kosten dessen geschehen darf, was wertvoller ist: der Erde selbst.